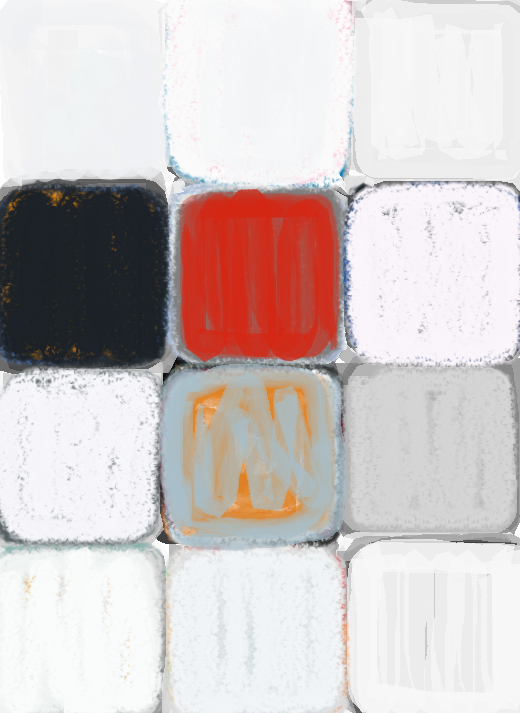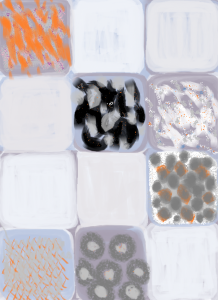Jede Sprachtheorie hat eine politische Seite. Denn das, was über die Sprache gesagt wird, impliziert auch dort, wo es in einer Terminologie scheinbar objektiver Wissenschaftlichkeit geschieht, notwendigerweise eine Konzeption der Gesellschaft und das heißt eine politische Ethik. Das zeigt sich mit besonderer Deutlichkeit in der Humboldt-Rezeption von Leo Weisgerber (1899-1985), der seiner Konzeption der Sprache bis in die Begrifflichkeiten hinein den Anstrich einer traditionsbewussten Fortführung des Humboldt’schen Sprachdenkens gegeben, tatsächlich aber eine Position vertreten hat, die sich von dem Humboldt’schen Projekt einer Anthropologie der Sprache entschieden abkehrt. Weisgerber hat mit einer an Humboldt gemahnenden Begrifflichkeit eine Theorie der Muttersprachlichkeit entwickelt, die die umfassende kulturelle und psychologische Abhängigkeit des einzelnen Sprechers von der Muttersprache betont. Die Muttersprache wird bei Weisgerber zu einer Schicksalsmacht erklärt, dem der Sprecher in allen seinen Lebensäußerungen unterworfen bleibt. 1929 schreibt er in Muttersprache und Geistesbildung:
Jede Sprachtheorie hat eine politische Seite. Denn das, was über die Sprache gesagt wird, impliziert auch dort, wo es in einer Terminologie scheinbar objektiver Wissenschaftlichkeit geschieht, notwendigerweise eine Konzeption der Gesellschaft und das heißt eine politische Ethik. Das zeigt sich mit besonderer Deutlichkeit in der Humboldt-Rezeption von Leo Weisgerber (1899-1985), der seiner Konzeption der Sprache bis in die Begrifflichkeiten hinein den Anstrich einer traditionsbewussten Fortführung des Humboldt’schen Sprachdenkens gegeben, tatsächlich aber eine Position vertreten hat, die sich von dem Humboldt’schen Projekt einer Anthropologie der Sprache entschieden abkehrt. Weisgerber hat mit einer an Humboldt gemahnenden Begrifflichkeit eine Theorie der Muttersprachlichkeit entwickelt, die die umfassende kulturelle und psychologische Abhängigkeit des einzelnen Sprechers von der Muttersprache betont. Die Muttersprache wird bei Weisgerber zu einer Schicksalsmacht erklärt, dem der Sprecher in allen seinen Lebensäußerungen unterworfen bleibt. 1929 schreibt er in Muttersprache und Geistesbildung:
„Das also erscheint mir als das Entscheidende: der Mensch, der in eine Sprache hineinwächst, steht für die Dauer seines Lebens unter dem Bann seiner Muttersprache, sie ist wirklich die Sprache, die für ihn denkt […] In diesem Sinne ist die Muttersprache Schicksal für den einzelnen, die Sprache des Volkes Schicksalsmacht für die Gemeinschaft.“ (Weisgerber 1929, 164).
Weisgerber formuliert damit schon vor 1933 eine Sprachtheorie, die die sprach- und bildungspolitischen Ziele des Dritten Reiches zu legitimieren vermag. Möglich wird Weisgerbers deterministischer Sprachbegriff über eine folgenreiche Verkürzung der Humboldt’schen Sprachidee durch die Gleichsetzung zwischen den Begriffen „Sprache“ und „Einzelsprache“. Die Einzelsprache, genauer gesagt, die Muttersprache ist bei Weisgerber die ganze Sprache, es gibt nichts außer ihr und alles, Nation, Kultur, Denken und Dichtung hängen von ihr ab.
Im Gegensatz dazu versteht Humboldt unter „Sprache“ einen unaufhörlichen geschichtlichen Prozess zwischen den Sprechern einer Sprache, in dem sich sowohl Individualität als auch Kollektivität (und zwar in einer ständigen Wechselwirkung) ausbilden. Man muss diese Wechselwirkung denken, wenn man verstehen will, was Humboldt meint, wenn er schreibt, dass die Sprache
„auch verbindet, indem sie vereinzelt, und in die Hülle des individuellsten Ausdrucks die Möglichkeit allgemeinen Verständnisses einschließt (Humboldt, Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaus 1827/29: 160, §11).
Voraussetzung für ein solches Denken ist die Erkenntnis, dass die Sprache nicht auf die Einzelsprache reduziert werden darf und dass der Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur, Sprache und Subjekt unerklärbar bleibt, wenn man nicht erkennt, dass sich Sprache empirisch immer in der alltäglichen Unvorhersehbarkeit der konkreten Rede ereignet. Auf diese Tatsache bezieht sich der berühmte, einzige kursiv gesetzte Satz in Humboldt Schrift Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbau:
Die Sprache liegt nur in der verbundenen Rede, Grammatik und Wörterbuch sind kaum ihrem todten Gerippe vergleichbar. (Humboldt 1827/29: 186, § 32)
Humboldts Sprachbegriff ist gerade in einer Gesellschaft, die nur bestehen kann, wenn sie die in ihr anzutreffende kulturelle Vielfalt ermöglicht und fördert, von zentraler Bedeutung, weil mit ihm ein Sprachdenken beginnt, das die Verbindung von Gemeinsamkeit und Vielfalt in der Sprache zu erkennen vermag. Und weil durch sie erklärbar wird, warum sprachliche Bildung das Herzstück einer demokratischen Kultur darstellt. Denn die Verkürzungen Weisgerbers, durch einen Sprachbegriff, der die Sprache nur als langue, nicht aber als parole denkt, der nur Grammatik und Wörterbuch kennt, nicht aber die unendliche Vielfalt des tatsächlichen Sprechens und damit die unerschöpflichen Möglichkeiten der sprachlichen Individuation, sind noch immer gegenwärtig.
Hans Lösener (2000): Zweimal Sprache – Weisgerber und Humboldt
 Sprachtheorie erscheint in didaktischen Diskussionen meist als ein Gegenstand, auf den lediglich verwiesen wird, der aber keiner weiteren Diskussion mehr bedarf. Die sprachtheoretischen Fragen sind offensichtlich immer schon geklärt, wenn Probleme des Unterrichts reflektiert werden. Dabei sind es auch hier gerade die Gewissheiten, die sich dem Denken in den Weg stellen, z. B. die Vorstellung, dass die Sprache aus Zeichen besteht und ihre Funktionsweise über deren Gebrauch erklärt werden kann. Der vorliegende Artikel weist auf die Aktualität Nietzsches hin, der in „Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne“ die unausweichliche Deanthropologisierung der Sprache aus dem Blickwinkel des Zeichens durchgespielt hat ,und weist die Folgen des Zeichendenkens in Musteraufgabenstellungen der Bildungsstandards nach.
Sprachtheorie erscheint in didaktischen Diskussionen meist als ein Gegenstand, auf den lediglich verwiesen wird, der aber keiner weiteren Diskussion mehr bedarf. Die sprachtheoretischen Fragen sind offensichtlich immer schon geklärt, wenn Probleme des Unterrichts reflektiert werden. Dabei sind es auch hier gerade die Gewissheiten, die sich dem Denken in den Weg stellen, z. B. die Vorstellung, dass die Sprache aus Zeichen besteht und ihre Funktionsweise über deren Gebrauch erklärt werden kann. Der vorliegende Artikel weist auf die Aktualität Nietzsches hin, der in „Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne“ die unausweichliche Deanthropologisierung der Sprache aus dem Blickwinkel des Zeichens durchgespielt hat ,und weist die Folgen des Zeichendenkens in Musteraufgabenstellungen der Bildungsstandards nach.