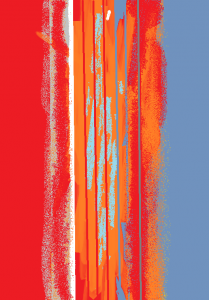… nicht nur die Linguistik angeht
Jahrhundertelang wurde in der Philosophie über Sprache nachgedacht, ohne dass jemand auf die Idee gekommen wäre, dass es dazu einer Sprachtheorie bedarf. Seit der Antike verstand man unter Sprache die Wörter, die Menschen benutzen, um die Dinge der Welt zu benennen oder ihre Gedanken mitzuteilen. Wozu eine Theorie, wenn das, worum es geht, so offensichtlich ist? Der erste, der dieser Gewissheit misstraute und in ihr die Ursache für gravierende Irrtümer über Sprache und ihre Funktionsweise erkannte, war Ferdinand de Saussure (1857–1913), der Begründer der theoretischen Sprachwissenschaft. Saussure griff ein Problem auf, das vor ihm niemand ernst genommen hatte, dass nämlich die Sprache kein beliebiger Gegenstand ist, den man untersuchen kann, sobald man sein Vorhandensein festgestellt hat. Die Sprache ist nicht einfach „da“, eben, weil sie immer schon „da“ ist, wenn man damit beginnt, über sie nachzudenken. Sowenig wie sich auf „die Realität“ aus einer Außenperspektive schauen lässt, weil wir immer schon ein Teil von ihr sind und wir nicht einmal für einen kurzen Moment – der Traum aller Mystiker! – aus ihr heraustreten können, so wenig ist uns ein Blick von außen auf die Sprache vergönnt. Wie das wäre, wenn wir es dennoch könnten, hat Friedrich Nietzsche ausphantasiert, in seinem Fragment „Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne“ (1873) – ein faszinierender Text, sicherlich, aber eben eine Phantasie, keine Theorie der Sprache.
Wir können nicht aus der Sprache heraustreten, um sie zu betrachten. Dieses Faktum hat weitreichende Konsequenzen. Die gravierendste ist, dass wir nicht von einem Gegenstand „Sprache“ ausgehen können, den wir einfach untersuchen und beschreiben, weil wir ihn vorfinden (zum Beispiel in unserem Kopf). Was wir stattdessen tun müssen, beschreibt Saussure in seinen posthum veröffentlichten Aufzeichnungen. An einer Stelle heißt es dort:
„Anderswo gibt es Dinge, <gegebene Gegenstände,> bei denen es einem freisteht, sie <hinterher> unter verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten. Hier gibt es zunächst Gesichtspunkte, richtige oder falsche, <aber einzig Gesichtspunkte>, mit Hilfe deren [sic] man <sekundär> Dinge SCHAFFT. Diese Schöpfungen entsprechen Realitäten, wenn der Ausgangspunkt richtig ist, oder sie entsprechen ihnen nicht im gegenteiligen Fall: Aber in beiden Fällen ist kein Ding, kein Gegenstand <auch nur einen Moment in sich selbst> gegeben. Auch dann nicht, wenn es um die allermateriellste Tatsache geht, die am offensichtlichsten in sich selbst definiert zu sein scheint wie zum Beispiel eine Folge von stimmlichen Lauten.“
(Saussure/Fehr 1997, 301).
Nun ja, möchte man einwenden, aber ich weiß doch, was ich meine, wenn ich „Sprache“ sage, wenn ich von „Wörtern“ oder von „Lauten“ der Sprache spreche? Das Problem dieser Gewissheit liegt in der Konstitution von Überzeugungen, die sich nicht einer direkten Wahrnehmung verdanken, wie man meinen könnte („Ich höre doch Sätze und Wörter, also muss es sie geben?“), sondern einer Modellierung, die wir unablässig mit dem Gegenstand, den sie repräsentiert, verwechseln. Diese Modellierung ist die Schriftlichkeit, die wir unseren Alphabetschriften verdanken. Tatsächlich sind Wörter und Sätze, ja sogar „Laute“ – was immer man darunter versteht – keine hörbaren Einheiten der Sprache; wären sie es, so könnte man diese Einheiten zweifelsfrei bestimmen, wenn man jemanden eine Sprache sprechen hört, die man nicht ansatzweise versteht. Genau das gelingt nicht: Wer kein Japanisch kann, kann aus dem Lautstrom einer japanischen Äußerung keine einzelnen Wörter heraushören oder bestimmen, wo ein Wort beginnt und wo es aufhört. Wir glauben, Wörter, Sätze und „Laute“ zu hören, weil wir wissen, wie sie geschrieben werden. Die Schrift macht Sprache sichtbar und verstellt zugleich die Möglichkeit sie anders denn als Schrift wahrzunehmen. Wer einmal die Schriftbrille aufgesetzt hat (und das haben alle, die den Schriftspracherwerb erfolgreich durchlaufen haben), dem fällt es nicht nur schwer, sie wieder abzusetzen, er kommt nicht einmal auf die Idee, dass er sie aufhat.
Wer die Sprache durch die Schriftbrille sieht, ist aber nicht einfach blind. Die Schrift macht ja vieles sichtbar, was wir ohne sie nicht wüssten, so dass der schriftvermittelten Sprachvorstellung durchaus die Qualität einer Theorie zukommt, denn sie schafft jenen Gesichtspunkt, den Saussure in dem obigen Zitat so vehement einfordert. Nur ermöglicht dieser Gesichtspunkt noch keine Sprachtheorie. Denn das, was die Schriftbrille zeigt, sind Zeichen, einfach deshalb, weil Schrift aus Zeichen besteht und ihre Funktionsweise daher eine semiotische ist – jedenfalls auf den ersten Blick. Wer mit der Schriftbrille auf die Sprache blickt, sieht Zeichen, man könnte sogar sagen, sieht überall nur Zeichen, weshalb jede Theorie, die diesen Ausgangspunkt wählt, innerhalb der Zeichentheorie bleibt und bleiben muss. Zeichentheorie oder Sprachtheorie, das ist die unvermeidliche Alternative, wenn man sich auf den Weg macht, die Sprache zu denken. Denn Sprache und Zeichen sind zwei grundverschiedene Angelegenheiten, wer das eine für das andere hält, wird der Sprache in ihrer Spezifik nicht gerecht werden können. Es gibt einen Philosophen, nämlich Wilhelm von Humboldt (1767–1835), der dieses Problem bereits vor Saussure gesehen hat. In einer seiner frühen Schriften wendet Humboldt sich entschieden gegen die Vorstellung, „dass die Sprache durch Konvention entstanden, und das Wort nichts als Zeichen einer unabhängig von ihm vorhandenen Sache, oder eines ebensolchen Begriffs ist“ (Humboldt 1806, 7). Humboldt denkt die Sprache nicht vom Zeichen her, sondern vom Menschen, als Tätigkeit des jedesmaligen Sprechens, in der das Denken, Wahrnehmen und Verstehen immer wieder neu hervorgebracht wird. Für Humboldt ist die Sprache kein bloßer Zeichengebrauch, weil er das Menschsein von der Sprache her denkt und umgekehrt und so, vermutlich als erster, eine Anthropologie der Sprache begründet.
Sprachtheorie oder Zeichentheorie – um diese Alternative geht es auf den folgenden Seiten, die sich an den Arbeiten des in Deutschland nach wie vor kaum bekannten Sprachdenkers Henri Meschonnic (1932–2009) orientieren. Henri Meschonnic deshalb, weil niemand vor oder nach ihm mit dieser Konsequenz die Problematik der Eliminierung der Sprachtheorie durch die Zeichentheorie analysiert hat. Meschonnic denkt weiter, was mit Wilhelm von Humboldt und Ferdinand de Saussure beginnt. Was auch bedeutet, dass man beide anders und neu entdecken kann, wenn man sie mit Meschonnic liest. Denn dass Saussure das Paradigma des Zeichens überwindet, um die Sprache zu denken, erschließt sich keineswegs auf den ersten Blick. Schließlich ist in Saussures posthum erschienenem Cours de linguistique générale, dem Buch, das ihn berühmt gemacht hat und das er nicht selbst verfasst hat (Jäger 2010), immer wieder vom „signe linguistique“, vom sprachlichen Zeichen die Rede. Aber das Zeichenprinzip hängt nicht allein am Wort „Zeichen“. Das, worum es geht, ist eine Sicht auf die Sprache, die eine semiotische Reduktion impliziert und die in Saussures Aufzeichnungen und in den Mitschriften seiner Studenten, die nicht in die veröffentlichte Fassung des Cours eingeflossen sind, einer grundlegenden Kritik unterzogen wird. Dazu gehört die uralte und hochaktuelle Vorstellung einer Art von mentalem Lexikon, das auf der einen Seite die Bedeutungen und auf der anderen die Wörter auflistet. So funktioniert Sprache gerade nicht, wie Saussure zeigt, weshalb er die Sprachursprungshypothesen, die von einer auf Konvention beruhenden Verbindung zwischen Wort und Bedeutung, ins Reich der Illusionen verbannt. Ohne Saussure gelesen zu haben, wird der späte Ludwig Wittgenstein (1889–1951) in seinen philosophischen Untersuchungen diese Kritik weiter entfalten.
Wer die Sprache innerhalb des Zeichenmodells denkt, setzt implizit die Trennbarkeit von Inhalt und Form, Bedeutung und Bezeichnung, Ideen und Wörtern, Geist und Welt etc. voraus. Tatsächlich ist die Zeichentheorie nicht nur ein Modell für sprachliche Kommunikation, sondern bildet ein transdisziplinäres Paradigma, das unsere wissenschaftlichen, philosophischen, gesellschaftlichen und politischen Vorstellungen seit der Antike prägt. Meschonnic hat für diese epistemologische Funktion der Zeichentheorie den Begriff des„Zeichendenken“ (pensée de signe) vorgeschlagen. Die Logik des Zeichendenkens mit seiner asymmetrischen Zweiteilung in Form und Inhalt (der Inhalt dominiert die Form, die Form dient dem Inhalt) ist nach Meschonnic verantwortlich für ganze Serien von Dualismen, die unsere Kultur- und Denktraditionen nach wie vor bestimmen: Natur und Kultur, Frau und Mann, wild und zivilisiert, Kind und Erwachsener, Gefühl und Verstand, Orient und Okzident etc. Wie beim Zeichen, wo der Inhalt das Primäre, die Form das Sekundäre ist, wird in all diesen Fällen ein Herrschaftsverhältnis begründet, das eine Seite zugunsten der anderen abwertet, schwächt und zugleich als unverzichtbares Element beibehält.
Das Zeichendenken geht nach Meschonnic alle an, weil es politisch wirksam ist und dort vorherrscht, wo es keiner Kritik unterzogen wird – und diese Kritik, das ist Meschonnics zentrale Hypothese, beginnt eben mit der Kritik unserer Sprachvorstellungen, der Kritik am Zeichendenken und deshalb auch an der Zeichentheorie, die nur von Sprachtheorie aus geleistet werden kann.
Wer Meschonnic auf Deutsch lesen möchte, kann das inzwischen auch. 2021 ist bei Matthes & Seitz „Ethik und Politik des Übersetzens“ erschienen, in einer von Béatrice Costa besorgten Übersetzung .
Hans Lösener, 2023
Wilhelm von Humboldt (1806): Über die Natur der Sprache im allgemeinen. Aus: Latium und Hellas. In: Michael Böhler (Hg.): Wilhelm von Humboldt. Schriften zur Sprache. Stuttgart: Reclam 1973.
Ludwig Jäger (2010): Ferdinand de Saussure zur Einführung. Hamburg: Junius.
Henri Meschonnic (2021): Ethik und Politik des Übersetzens. Aus dem Französischen von Béatrice Costa. Berlin: Matthes & Seitz.
Friedrich Nietzsche (1988): Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne [1873]. In: Ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden. Hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Bd. 1: Die Geburt der Tragödie. Unzeitgemäße Betrachtungen I–IV. Nachgelassene Schriften 1870–1873. München: dtv, S. 873–890.
Ferdinand de Saussure (1997): Linguistik und Semiologie. Notizen aus dem Nachlaß. Texte, Briefe und Dokumente. Gesammelt, übersetzt und eingeleitet von Johannes Fehr. Frankfurt am Main: Suhrkamp.